Diesmal: Muss es eigentlich immer Wachstum geben?
In der „Wirtschaft“ ist es ja heute so: Panik bricht aus, wenn es nicht mehr wächst. Die Wirtschaft muss wachsen. Die Einheut des Wachstums ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP).
Immer wieder vernimmt mensch allerdings auch die Frage, ob das genau so sein muss und ob das eigentlich logisch ist. Erstaunlich ist dabei in Zeiten von Finanz- und Schuldenkrisen, großen und kleinen „Crashs“ und Zahlungsunfähigkeiten nur, wie selten diese Frage fällt.
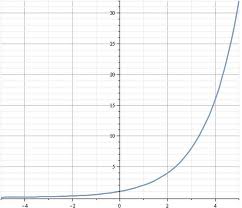
Denn der herkömmliche Wachstumsbegriff kann schon lange nicht mehr überzeugen. Er nimmt eine rein quantitative Bewertung vor und denkt kurzfristig, blendet also mittel- und langfristige Folgen des Wachstums aus. Würde man eine langfristige Betrachtungsweise zugrunde legen, käme man zu dem Schluss, dass viel vermeintliches Wachstum mehr zerstört als aufbaut. Denn vielfach werden die Folgen blinden Wachstums mit der Zeit ziemlich teuer, wenn die Zerstörung von Natur und Ressourcen in Rechnung gestellt wird. Und die globalen Folgen des Klimawandels möchte mensch lieber nicht ökonomisch erfassen.
Generell dürfen wir gerne auch fragen, worin der tiefere Sinn des Wachsens besteht. Als Selbstzweck ist „Wachstum“ jedenfalls eine untaugliche Philosophie.
Einen Versuch der Neubestimmung unternimmt der Green New Deal: So hat der vorherrschende Wachstumsbegriff mit seinem Mantra des „Immer mehr“ zu kurzfristiger Profitgier und Raubbau an Natur und Menschen geführt. Sinnvoll kann im Gegensatz dazu allerdings ein qualitatives, „nachhaltiges“ Wachstum sein, in dem natürliche Ressourcen und menschliche Arbeitskraft nicht als Quelle der Ausbeutung gesehen werden.
Eine nachhaltige Wirtschaftsweise drückt sich nicht vor jener Realität, dass bei bestimmten Ressourcen Knappheit herrscht und diese nicht zu ersetzen sind.